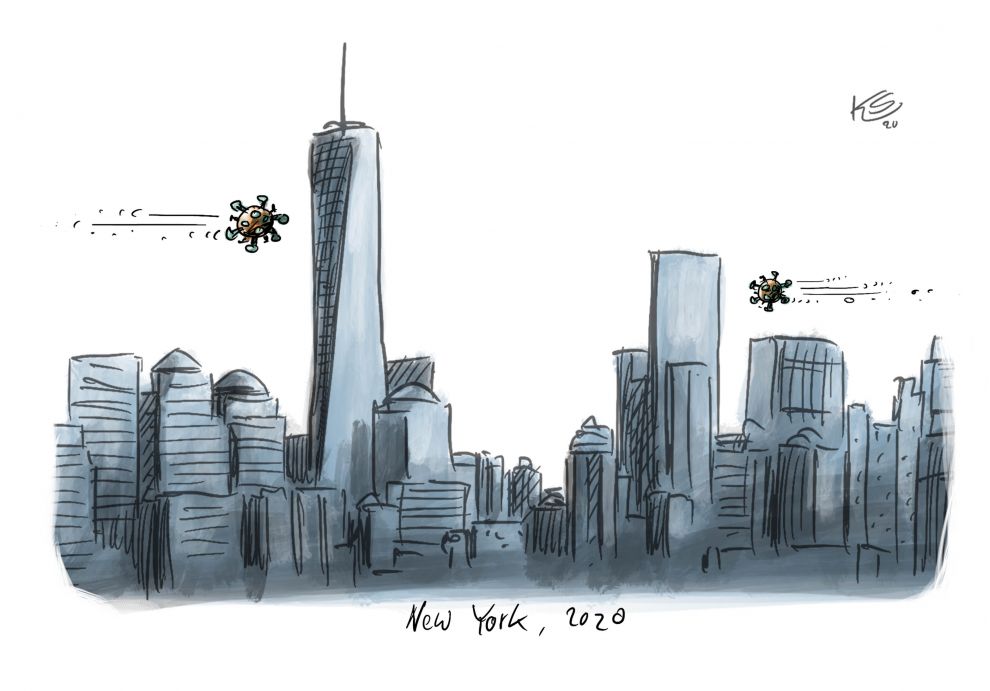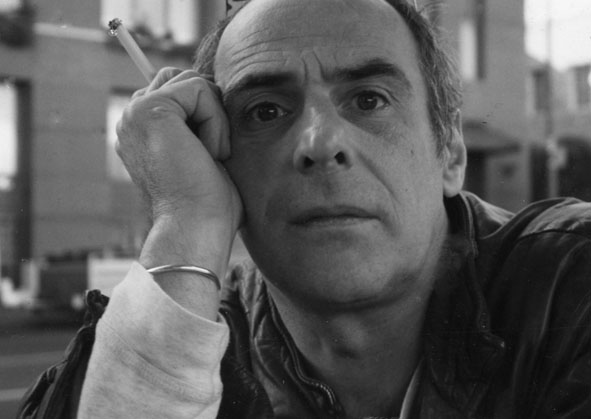|
Der Tannenbaum
Draußen im Walde
stand ein niedlicher, kleiner Tannenbaum; er hatte einen guten
Platz, Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da, und
ringsumher wuchsen viel größere Kameraden, sowohl Tannen als
Fichten. Aber dem kleinen Tannenbaum schien nichts so wichtig
als das Wachsen; er achtete nicht der warmen Sonne und der
frischen Luft, er kümmerte sich nicht um die Bauerkinder, die da
gingen und plauderten, wenn sie herausgekommen waren, um
Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem
ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm
gezogen, dann setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und
sagten: »Wie niedlich klein ist der!« Das mochte der Baum gar
nicht hören.
Im folgenden Jahre
war er ein langes Glied größer, und das Jahr darauf war er um
noch eins länger, denn bei den Tannenbäumen kann man immer an
den vielen Gliedern, die sie haben, sehen, wie viele Jahre sie
gewachsen sind.
»O, wäre ich doch so
ein großer Baum wie die andern!« seufzte das kleine Bäumchen.
»Dann könnte ich meine Zweige so weit umher ausbreiten und mit
der Krone in die weite Welt hinausblicken! Die Vögel würden dann
Nester zwischen meinen Zweigen bauen, und wenn der Wind weht,
könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die andern dort!«
Er hatte gar keine
Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und den roten Wolken, die
morgens und abends über ihn hinsegelten.
War es nun Winter
und der Schnee lag ringsumher funkelnd weiß, so kam häufig ein
Hase angesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum weg.
O, das war ärgerlich! Aber zwei Winter vergingen und im dritten
war das Bäumchen so groß, daß der Hase im dasselbe herumlaufen
mußte. »O, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch
das einzige Schöne in dieser Welt!« dachte der Baum.
Im Herbst kamen
immer Holzhauer und fällten einige der größten Bäume; das
geschah jedes Jahr, und dem jungen Tannenbaum, der nun ganz gut
gewachsen war, schauderte dabei; denn die großen, prächtigen
Bäume fielen mit Knacken und Krachen zur Erde, die Zweige wurden
abgehauen, die Bäume sahen ganz nackt, lang und schmal aus; sie
waren fast nicht zu erkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen
gelegt und Pferde zogen sie davon, aus dem Walde hinaus.
Wohin sollten sie?
Was stand ihnen bevor?
Im Frühjahr, als die
Schwalben und Störche kamen, fragte sie der Baum: »Wißt Ihr
nicht, wohin sie geführt wurden? Seid Ihr ihnen begegnet?«
Die Schwalben wußten
nichts, aber der Storch sah nachdenkend aus, nickte mit dem
Kopfe und sagte: »Ja, ich glaube wohl; mir begegneten viele neue
Schiffe, als ich aus Ägypten flog; auf den Schiffen waren
prächtige Mastbäume; ich darf annehmen, daß sie es waren, sie
hatten Tannengeruch; ich kann vielmals grüßen, sie prangen, sie
prangen!«
»O, wäre ich doch
auch groß genug, um über das Meer hinfahren zu können! Was ist
das eigentlich, dieses Meer, und wie sieht es aus?«
»Ja, das ist
weitläufig zu erklären!« sagte der Storch und damit ging er.
»Freue Dich Deiner
Jugend!« sagten die Sonnenstrahlen; »freue Dich Deines frischen
Wachstums, des jungen Lebens, das in Dir ist!«
Und der Wind küßte
den Baum, und der Tau weinte Thränen über denselben, aber das
verstand der Tannenbaum nicht.
Wenn es gegen die
Weihnachtszeit war, wurden ganz junge Bäume gefällt, Bäume, die
oft nicht einmal so groß oder gleichen Alters mit diesem
Tannenbaume waren, der weder Rast noch Ruhe hatte, sondern immer
davon wollte; diese jungen Bäume, und es waren gerade die
allerschönsten, behielten immer alle ihre Zweige; sie wurden auf
Wagen gelegt und Pferde zogen sie von dannen zum Walde hinaus.
»Wohin sollen
diese?« fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich,
Einer ist sogar viel kleiner; weswegen behalten sie alle ihre
Zweige? Wohin fahren sie?«
»Das wissen wir! Das
wissen wir!« zwitscherten die Sperlinge. »Unten in der Stadt
haben wir in die Fenster gesehen! Wir wissen, wohin sie fahren!
O, sie gelangen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man
sich denken kann! Wir haben in die Fenster gesehen und erblickt,
daß sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und mit den
schönsten Sachen, vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und
vielen hundert Lichtern geschmückt werden.«
»Und dann?« fragte
der Tannenbaum und bebte in allen Zweigen. »Und dann? Was
geschieht dann?«
»Ja, mehr haben wir
nicht gesehen! Das war unvergleichlich schön!«
»Ob ich wohl
bestimmt bin, diesen strahlenden Weg zu betreten?« jubelte der
Tannenbaum. »Das ist noch besser, als über das Meer zu ziehen!
Wie leide ich an Sehnsucht! Wäre es doch Weihnachten! Nun bin
ich hoch und entfaltet wie die andern, die im vorigen Jahre
davongeführt wurden! O, wäre ich erst auf dem Wagen, wäre ich
doch in der warmen Stube mit all' der Pracht und Herrlichkeit!
Und dann? Ja, dann kommt noch etwas Besseres, noch Schöneres,
warum würden sie mich sonst so schmücken? Es muß noch etwas
Größeres, Herrlicheres kommen! Aber was? O, ich leide, ich sehne
mich, ich weiß selbst nicht, wie es mir ist!«
»Freue Dich unser!«
sagten die Luft und das Sonnenlicht; »freue Dich Deiner frischen
Jugend im Freien!«
Aber er freute sich
durchaus nicht; er wuchs und wuchs, Winter und Sommer stand er
grün; dunkelgrün stand er da, die Leute, die ihn sahen, sagten:
»Das ist ein schöner Baum!« und zur Weihnachtszeit wurde er von
allen zuerst gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark; der Baum
fiel mit einem Seufzer zu Boden, er fühlte einen Schmerz, eine
Ohnmacht, er konnte gar nicht an irgend ein Glück denken, er war
betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen, von dem Flecke, auf
dem er emporgeschossen war; er wußte ja, daß er die lieben,
alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher nie
mehr sehen werde, ja vielleicht nicht einmal die Vögel. Die
Abreise hatte durchaus nichts Behagliches.
Der Baum kam erst
wieder zu sich selbst, als er im Hofe, mit andern Bäumen
abgeladen, einen Mann sagen hörte: »Dieser hier ist prächtig!
Wir brauchen nur diesen!«
Nun kamen zwei
Diener im vollen Staat und trugen den Tannenbaum in einen
großen, schönen Saal. Ringsherum an den Wänden hingen Bilder,
und bei dem großen Kachelofen standen große chinesische Vasen
mit Löwen auf den Deckeln; da waren Wiegestühle, seidene Sophas,
große Tische voll von Bilderbüchern und Spielzeug für hundertmal
hundert Thaler; wenigstens sagten das die Kinder. Der Tannenbaum
wurde in ein großes, mit Sand gefülltes Faß gestellt, aber
niemand konnte sehen, daß es ein Faß war, denn es wurde rund
herum mit grünem Zeug behängt und stand auf einem großen, bunten
Teppich. O, wie der Baum bebte! Was wird da doch vorgehen?
Sowohl die Diener, als die Fräulein schmückten ihn. An einen
Zweig hängten sie kleine Netze aus farbigem Papier
ausgeschnitten, jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt;
vergoldete Äpfel und Wallnüsse hingen herab, als wären sie fest
gewachsen und über hundert rote, blaue und weiße kleine Lichter
wurden in den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaft wie die
Menschen aussahen – der Baum hatte früher nie solche gesehen –
schwebten im Grünen, und hoch oben in der Spitze wurde ein Stern
von Flittergold befestigt. Das war prächtig, ganz
außerordentlich prächtig!
»Heute Abend,«
sagten alle, »heute Abend wird es strahlen!«
»O,« dachte der
Baum, »wäre es doch Abend! Würden nur die Lichter bald
angezündet! Und was dann wohl geschieht? Ob da wohl Bäume aus
dem Walde kommen, mich zu sehen? Ob die Sperlinge gegen die
Fensterscheiben fliegen? Ob ich hier festwachse und Winter und
Sommer geschmückt stehen werde?«
Ja, er wußte gut
Bescheid; aber er hatte ordentlich Borkenschmerzen vor lauter
Sehnsucht, und Borkenschmerzen sind für einen Baum eben so
schlimm wie Kopfschmerzen für uns andere.
Nun wurden die
Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum bebte
in allen Zweigen dabei, so daß eins der Lichter das Grüne
anbrannte; es sengte ordentlich.
»Gott bewahre uns!«
schrieen die Fräulein und löschten es hastig aus.
Nun durfte der Baum
nicht einmal beben. O, das war ein Grauen! Ihm war bange, etwas
von seinem Staate zu verlieren; er war ganz betäubt von all' dem
Glanze. Da gingen beide Flügelthüren auf, und eine Menge Kinder
stürzten herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen, die
älteren Leute kamen bedächtig nach; die Kleinen standen ganz
stumm, aber nur einen Augenblick, dann jubelten sie wieder, daß
es laut schallte, sie tanzten um den Baum herum, und ein
Geschenk nach dem andern wurde abgepflückt.
»Was machen sie?«
dachte der Baum. »Was soll geschehen?« Die Lichter brannten
gerade bis auf die Zweige herunter, und je nachdem sie
niederbrannten, wurden sie ausgelöscht, und dann erhielten die
Kinder die Erlaubnis, den Baum zu plündern. O, sie stürzten auf
denselben ein, daß es in allen Zweigen knackte; wäre er nicht
mit der Spitze und mit dem Goldsterne an der Decke festgemacht
gewesen, so wäre er umgestürzt.
Die Kinder tanzten
mit ihrem prächtigen Spielzeug herum, niemand sah nach dem
Baume, ausgenommen das alte Kindermädchen, welches kam und
zwischen die Zweige blickte; aber es geschah nur, um zu sehen,
ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen sei.
»Eine Geschichte,
eine Geschichte!« riefen die Kinder und zogen einen kleinen,
dicken Mann gegen den Baum hin, und er setzte sich gerade unter
denselben, »denn so sind wir im Grünen,« sagte er, »und der Baum
kann besonders Nutzen davon haben, zuzuhören! Aber ich erzähle
nur eine Geschichte. Wollt Ihr die von Ivede-Avede oder die von
Klumpe-Dumpe hören, der die Treppen hinunterfiel und doch erhöht
wurde und die Prinzessin erhielt?«
»Ivede-Avede!«
schrieen einige, »Klumpe-Dumpe!« schrieen andere. Das war ein
Rufen und Schreien! Nur der Tannenbaum schwieg ganz still und
dachte: »Komme ich garnicht mit, werde ich nichts dabei zu thun
haben?« Er war ja mit gewesen, hatte ja geleistet, was er
sollte.
Der Mann erzählte
von Klumpe-Dumpe, welcher die Treppen hinunterfiel und doch
erhöht wurde und die Prinzessin erhielt. Und die Kinder
klatschten in die Hände und riefen: »Erzähle, erzähle!« Sie
wollten auch die Geschichte von Ivede-Avede hören, aber sie
bekamen nur die von Klumpe-Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz
stumm und gedankenvoll, nie hatten die Vögel im Walde
dergleichen erzählt. »Klumpe-Dumpe fiel die Treppen hinunter und
bekam doch die Prinzessin! Ja, ja, so geht es in der Welt zu!«
dachte der Tannenbaum und glaubte, daß es wahr sei, weil es ein
so netter Mann war, der es erzählte. »Ja, ja! Vielleicht falle
ich auch die Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin!« Und
er freute sich, den nächsten Tag wieder mit Lichtern und
Spielzeug, Gold und Früchten aufgeputzt zu werden.
»Morgen werde ich
nicht zittern!« dachte er. »Ich will mich recht aller meiner
Herrlichkeit freuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von
Klumpe-Dumpe und vielleicht auch die von Ivede-Avede hören.« Und
der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll.
Am Morgen kamen die
Diener und das Mädchen herein.
»Nun beginnt der
Staat aufs neue!« dachte der Baum; aber sie schleppten ihn zum
Zimmer hinaus, die Treppe hinauf, auf den Boden, und stellten
ihn in einen dunkeln Winkel, wohin kein Tageslicht schien. »Was
soll das bedeuten?« dachte der Baum. »Was soll ich hier wohl
machen? Was mag ich hier wohl hören sollen?« Er lehnte sich
gegen die Mauer und dachte und dachte. Und er hatte Zeit genug,
denn es vergingen Tage und Nächte; niemand kam herauf, und als
endlich jemand kam, so geschah es, um einige große Kasten in den
Winkel zu stellen; der Baum stand ganz versteckt, man mußte
glauben, daß er ganz vergessen war.
»Nun ist es Winter
draußen!« dachte der Baum. »Die Erde ist hart und mit Schnee
bedeckt, die Menschen können mich nicht pflanzen; deshalb soll
ich wohl bis zum Frühjahr hier im Schutz stehen! Wie wohl
bedacht ist das! Wie die Menschen doch so gut sind! Wäre es hier
nur nicht so dunkel und schrecklich einsam! Nicht einmal ein
kleiner Hase! Das war doch niedlich da draußen im Walde, wenn
der Schnee lag und der Hase vorbei sprang, ja selbst als er über
mich hinweg sprang; aber damals mochte ich es nicht leiden. Hier
oben ist es doch schrecklich einsam!«
»Pip, pip!« sagte da
eine kleine Maus und huschte hervor; und dann kam noch eine
kleine. Sie beschnüffelten den Tannenbaum und dann schlüpften
sie zwischen dessen Zweige.
»Es ist eine
gräuliche Kälte!« sagten die kleinen Mäuse. »Sonst ist hier gut
sein; nicht wahr, Du alter Tannenbaum?«
»Ich bin gar nicht
alt!« sagte der Tannenbaum; »es giebt viele, die weit älter sind
denn ich!«
»Woher kommst Du,«
fragten die Mäuse, »und was weißt Du?« Sie waren gewaltig
neugierig. »Erzähle uns doch von den schönsten Orten auf Erden!
Bist Du dort gewesen? Bist Du in der Speisekammer gewesen, wo
Käse auf den Brettern liegen und Schinken unter der Decke
hängen, wo man auf Talglicht tanzt, mager hineingeht und fett
herauskommt?«
»Das kenne ich
nicht,« sagte der Baum; »aber den Wald kenne ich, wo die Sonne
scheint und die Vögel singen!« Und dann erzählte er alles aus
seiner Jugend, die kleinen Mäuse hatten früher nie dergleichen
gehört, und sie horchten auf und sagten: »Wie viel Du gesehen
hast! Wie glücklich Du gewesen bist!«
»Ich?« sagte der
Tannenbaum und dachte über das, was er selbst erzählte, nach.
»Ja, es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten!« Aber dann
erzählte er vom Weihnachtsabend, wo er mit Kuchen und Lichtern
geschmückt war.
»O,« sagten die
kleinen Mäuse, »wie glücklich Du gewesen bist, Du alter
Tannenbaum!«
»Ich bin gar nicht
alt!« sagte der Baum; »erst in diesem Winter bin ich vom Walde
gekommen! Ich bin in meinem allerbesten Alter, ich bin nur so
aufgeschossen.«
»Wie schön Du
erzählst!« sagten die kleinen Mäuse, und in der nächsten Nacht
kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die den Baum erzählen
hören sollten, und je mehr er erzählte, desto deutlicher
erinnerte er sich selbst an alles und dachte: »Es waren doch
ganz fröhliche Zeiten! Aber sie können wiederkommen, können
wiederkommen! Klumpe-Dumpe fiel die Treppe hinunter und erhielt
doch die Prinzessin; vielleicht kann ich auch eine Prinzessin
bekommen.« Und dann dachte der Tannenbaum an eine kleine
niedliche Birke, die draußen im Walde wuchs; das war für den
Tannenbaum eine wirkliche schöne Prinzessin.
»Wer ist
Klumpe-Dumpe?« fragten die kleinen Mäuse. Da erzählte der
Tannenbaum das ganze Märchen, er konnte sich jedes einzelnen
Wortes entsinnen; die kleinen Mäuse waren aus reiner Freude
bereit, bis an die Spitze des Baumes zu springen. In der
folgenden Nacht kamen weit mehr Mäuse und am Sonntage sogar zwei
Ratten, aber die meinten, die Geschichte sei nicht hübsch, und
das betrübte die kleinen Mäuse, denn nun hielten sie auch
weniger davon.
»Wissen Sie nur die
eine Geschichte?« fragten die Ratten.
»Nur die eine,«
antwortete der Baum; »die hörte ich an meinem glücklichsten
Abend, aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich
war.«
»Das ist eine höchst
jämmerliche Geschichte! Kennen Sie keine von Speck und
Talglicht? Keine Speise kammergeschichte?«
»Nein!« sagte der
Baum.
»Ja, dann danken wir
dafür!« erwiderten die Ratten und gingen zu den ihrigen zurück.
Die kleinen Mäuse
blieben zuletzt auch weg, und da seufzte der Baum: »Es war doch
ganz hübsch, als sie um mich herum saßen, die beweglichen
kleinen Mäuse, und zuhörten, wie ich erzählte! Nun ist auch das
vorbei! Aber ich werde daran denken, mich zu freuen, wenn ich
wieder hervorgenommen werde.«
Aber wann geschah
das? Ja, es war eines Morgens, da kamen Leute und wirtschafteten
auf dem Boden; die Kasten wurden weggesetzt, der Baum wurde
hervorgezogen; sie warfen ihn freilich ziemlich hart gegen den
Fußboden, aber ein Diener schleppte ihn gleich nach der Treppe
hin, wo der Tag leuchtete.
»Nun beginnt das
Leben wieder!« dachte der Baum; er fühlte die frische Luft, die
ersten Sonnenstrahlen, und nun war er draußen im Hofe. Alles
ging geschwind, der Baum vergaß völlig, sich selbst zu
betrachten, da war so vieles ringsumher zu sehen. Der Hof stieß
an einen Garten, und alles blühte darin; die Rosen hingen frisch
und duftend über das kleine Gitter hinaus, die Lindenbäume
blühten, und die Schwalben flogen umher und sagten: »Quirrevirrevit,
mein Mann ist kommen!« Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie
meinten.
»Nun werde ich
leben!« jubelte dieser und breitete seine Zweige weit aus; aber
ach, die waren alle vertrocknet und gelb; und er lag da zwischen
Unkraut und Nesseln. Der Stern von Goldpapier saß noch oben in
der Spitze und glänzte im hellen Sonnenschein.
Im Hofe selbst
spielten ein Paar der munteren Kinder, die zur Weihnachtszeit
den Baum umtanzt hatten und so froh über denselben gewesen
waren. Eins der kleinsten lief hin und riß den Goldstern ab.
»Sieh, was da noch
an dem häßlichen, alten Tannenbaum sitzt!« sagte es und trat auf
die Zweige, so daß sie unter seinen Stiefeln knackten.
Der Baum sah auf
all' die Blumenpracht und Frische im Garten, er betrachtete sich
selbst und wünschte, daß er in seinem dunkeln Winkel auf dem
Boden geblieben wäre; er gedachte seiner frischen Jugend im
Walde, des lustigen Weihnachtsabends und der kleinen Mäuse, die
so munter die Geschichte von Klumpe-Dumpe angehört hatten.
»Vorbei, vorbei!«
sagte der arme Baum. »Hätte ich mich doch gefreut, als ich es
noch konnte! Vorbei, vorbei!«
Der Diener kam und
hieb den Baum in kleine Stücke, ein ganzes Bund lag da; hell
flackerte es auf unter dem großen Braukessel. Der Baum seufzte
tief und jeder Seufzer war einem kleinen Schusse gleich; des
halb liefen die Kinder, die da spielten, herbei und setzten sich
vor das Feuer, blickten in dasselbe hinein und riefen: »Piff,
paff!« Aber bei jedem Knalle, der ein tiefer Seufzer war, dachte
der Baum an einen Sommerabend im Walde oder an eine Winternacht
da draußen, wenn die Sterne funkelten; er dachte an den
Weihnachtsabend und an Klumpe-Dumpe, das einzige Märchen,
welches er gehört hatte und zu erzählen wußte – und dann war der
Baum verbrannt.
Die Knaben spielten
im Garten, und der kleinste hatte den Goldstern auf der Brust,
den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen; nun war der
vorbei, und mit dem Baum war es auch vorbei und mit der
Geschichte auch; vorbei, vorbei, und so geht es mit allen
Geschichten!
Anders,
H. C.
(1844):
Der Tannenbaum
Erstveröffentlichung (mit dem
Märchen "Die Schneekönigin" am 21. Dezember 1844 in der
Buchausgabe Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling (Neue
Abenteteur, Erster Band, Zweite Sammlung) vom Verleger C. A.
Reitzel
Quelle: Andersen, H[ans] C[hristian]:
Sämmtliche Märchen. Leipzig [um 1900], S. 1-11:
http://www.zeno.org
|
%20aus%20GW%20Band%201.jpg)
.jpg)

%2004.06.09.jpg)

.jpg)
%2003.11.13.jpg)
.jpg)
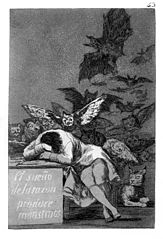

.jpg)
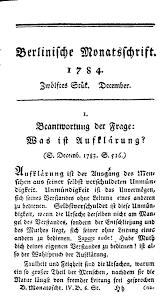



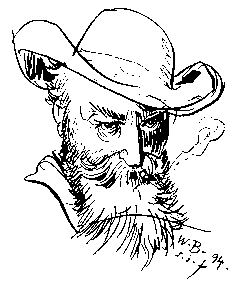
%20Bild%20von%20Frank%20Pfeiffer%20auf%20Pixabay%20(Ausschnitt).jpg)